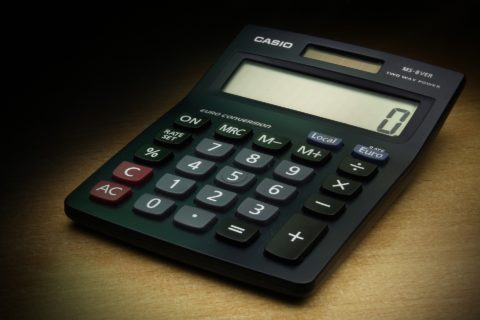Geschäftsführer eine Fondsgesellschaft sind gegenüber ihren Anlegern (Gesellschaftern) zur Aufklärung über die den Gesellschafts- und den Gesellschaftervermögen in der Vergangenheit zugefügten erheblichen Vermögensnachteile verpflichtet.
In dem hier vom Bundesgerichtshof entschiedenen Strafverfahren wäre bei einer auf verschiedene – vom Landgericht näher dargestellte – Weisen möglicher Information der Anleger über die Vermögensschädigungen zu Lasten der Fondsgesellschaften wären diejenigen Anleger, die die Entgelte für ihre Beteiligung ratenweise entrichteten, dazu veranlasst worden, nicht weiter an die Fondsgesellschaften zu zahlen. Die Minderung des Vermögens der Anleger durch fortgesetzte Zahlungen nach den Untreuehandlungen ist nach Ansicht des Landgerichts nicht durch die „Erweiterung“ ihrer Beteiligungsrechte an den Fondsgesellschaften wirtschaftlich ausgeglichen worden. Denn nach den erheblichen Untreuehandlungen zu Lasten der Fondsgesellschaften erwarben die Anleger vor dem Hintergrund der mit den Anlagen erstrebten Zwecke der Altersvorsorge und des langfristigen Vermögensaufbaus etwas anderes, als sie mit der Beteiligung an den Gesellschaften vertragsgemäß erreichen wollten.
Der Bundesgerichtshof ist in diesem Fall von einer Täuschung der Anleger durch Unterbleiben ihrer Aufklärung über die den Gesellschafts- und den Gesellschaftervermögen in der Vergangenheit seitens der Geschäftsführer zugefügten erheblichen Vermögensnachteile ausgegangen. Zu einer solchen Aufklärung waren die Geschäftsführer aber im Sinne von § 13 Abs. 1 StGB rechtlich verpflichtet. Sie haben daher die Betrugstaten zu Lasten der Anleger durch Unterlassen verwirklicht.
Diese Form der Verwirklichung eines Straftatbestandes ist gemäß § 13 Abs. 1 StGB nur dann strafbar, wenn der Täter rechtlich dafür einzustehen hat, dass der tatbestandliche Erfolg nicht eintritt, und wenn das Unterlassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes durch ein Tun entspricht. Zur Begründung der Strafbarkeit aus einem unechten Unterlassungsdelikt muss ein besonderer Rechtsgrund nachgewiesen werden, wenn jemand ausnahmsweise dafür verantwortlich gemacht werden soll, dass er es unterlassen hat, zum Schutz fremder Rechtsgüter positiv tätig zu werden. Die Gleichstellung des Unterlassens mit dem aktiven Tun setzt deshalb voraus, dass der Täter als „Garant“ für die Abwendung des tatbestandlichen Erfolges einzustehen hat. Alle Erfolgsabwendungspflichten beruhen auf dem Grundgedanken, dass eine bestimmte Person in besonderer Weise zum Schutz des gefährdeten Rechtsguts aufgerufen ist und dass sich alle übrigen Beteiligten auf das helfende Eingreifen dieser Person verlassen und verlassen dürfen1.
Auf der Grundlage dieser für sämtliche unechten Unterlassungsdelikte geltenden Anforderungen ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt, dass eine Strafbarkeit wegen Betrugs durch Unterlassen entweder als Täter oder als Teilnehmer für alle Personen in Frage kommt, die eine von § 13 Abs. 1 StGB erfasste Pflicht zur Aufklärung anderer über vermögensrelevante Tatsachen haben2. Die strafbarkeitsbegründende Pflicht zur Aufklärung eines Dritten über vermögensrelevante Umstände kann dabei aus verschiedenen Gründen herrühren3. Unabhängig vom Entstehungsgrund muss die Pflicht stets darauf gerichtet sein, unrichtigen oder unvollständigen Vorstellungen des Getäuschten über Tatsachen, die zu einer Vermögensschädigung führen können, durch aktive Aufklärung entgegenzuwirken (Satzger aaO § 263 Rn. 84; in der Sache ebenso Perron in Schönke/Schröder, StGB, 29. Aufl., § 263 Rn.19).
Nach diesen Maßstäben bejahte der Bundesgerichtshof im vorliegenden Fall eine Pflicht jedes Geschäftsführer, die ihre Beteiligung ratenweise bedienenden Gesellschafter der Fondsgesellschaften über die im Umfang erheblichen Veruntreuungen zu informieren.
Diese Pflicht findet zum einen gegenüber den Anlegern ihre Grundlage in den gesellschaftsvertraglichen Beziehungen zwischen den Gesellschaften und ihren Gesellschaftern.
Der Bundesgerichtshof nimmt eine auf vertragliche Beziehungen gestützte Aufklärungspflicht bezüglich vermögensrelevanter Tatsachen sowohl bei bestehenden Vertrauensverhältnissen als auch bei der Anbahnung besonderer, auf gegenseitigem Vertrauen beruhender Verbindungen an, bei denen Treu und Glauben und die Verkehrssitte die Offenbarung der für die Entschließung des anderen Teils wichtiger Umstände gebieten4. In der Strafrechtswissenschaft sind aus vertraglichen Beziehungen resultierende Vertrauensbeziehungen ebenfalls weithin als Quelle einer Aufklärungs- bzw. Informationspflicht anerkannt5; insbesondere bei Gesellschaftsverhältnissen (einschließlich stiller Beteiligungen) und bei Verträgen über Vermögensangelegenheiten6. Dementsprechend hat die Strafrechtsprechung bei der Begründung gesellschaftsrechtlicher Rechtsverhältnisse eine Aufklärungspflicht über dafür vermögensrelevante Umstände angenommen7.
Unter den hier festgestellten Verhältnissen der Fondsgesellschaften bestand eine in den gesellschaftsrechtlichen Beziehungen gründende Aufklärungspflicht über den erfolgten Entzug von Gesellschaftsvermögen für die Geschäftsführer jeweils gegenüber den An- legern der Fondsgesellschaften. Das hier maßgebliche besondere Vertrauensverhältnis zwischen den Anlegern als an den Fondsgesellschaften Beteiligten und den Gesellschaften ergibt sich – aus dem Konzept des sog. „blind pools“. Den Anlegern war weder bei Eingehen der Beteiligung noch während der Zeiträume der Erbringung der Anlagebeiträge bekannt, in welcher konkreten Weise die Anlagemittel durch die jeweils für die Fondsgesellschaften handelnden Personen eingesetzt werden würden. Sie waren daher in besonderer Weise darauf angewiesen und normativ berechtigt, darauf zu vertrauen, dass die für die Fondsgesellschaften Handelnden die angelegten Gelder lediglich im Rahmen der mit dem Beitritt zu den Gesellschaften verfolgten, in den Emissionsprospekten benannten Zwecke der Altersvorsorge und des langfristigen Vermögensaufbaus einsetzen würden. Insoweit wohnt den gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen der hier fraglichen Formen auch ein Beratungselement inne, bei dem der einzelne Anleger den Sachverstand der das Anlageprojekt auflegenden und verwaltenden (natürlichen) Personen in Anspruch nimmt. Verträge mit Beratungscharakter sind als Grundlage von betrugsstrafrechtlich bedeutsamen Aufklärungspflichten akzeptiert8.
Die Geschäftsführer waren in eigener Person aufgrund ihrer Stellung als Vertretungsorgan der Fondsgesellschaft selbst oder als Vertretungs- organ der die Gesellschaft vertretenden juristischen Person (Komplemtärin) aufklärungspflichtig. Als natürliche Personen standen sie zwar in keiner unmittelbaren (gesellschafts)vertraglichen Beziehung zu den Anlegern der Fondsgesellschaften. Ihre Garantenstellung und ihre daraus folgende Aufklärungspflicht gegenüber den Anlegern findet ihre Grundlage aber in der tatsächlichen Übernahme der Stellung als Vertretungsorgan der Fondsgesellschaften selbst. In dieser Position waren sie für die Vornahme der Investitionsentscheidungen über das Fondsvermögen verantwortlich, auf die sich das berechtigte Vertrauen der Anleger in eine den Gesellschaftszwecken entsprechende Mittelverwendung bezog. Der Heranziehung von § 14 Abs. 1 Nr. 1 StGB, auf den das Landgericht insoweit abstellt, bedarf es nicht. Die Vorschrift ist auf unechte Unterlassungsdelikte nicht anwendbar9. Die wie vorliegend begründete Aufklärungspflicht steht nicht in Widerspruch zu den Voraussetzungen der Vermögensbetreuungspflicht im Sinne von § 266 StGB10. Denn die Geschäftsführer waren aufgrund ihrer gesellschaftsrechtlichen Stellung gegenüber den Vermögen der Anleger als an den Gesellschaften Beteiligte ohnehin betreuungspflichtig.
Die Aufklärungspflicht bestand während des gesamten Zeitraums der gesellschaftsvertraglichen Bindung der Anleger als an den Fondsgesellschaften Beteiligte und nicht nur im Zeitpunkt der Anlageentscheidung. Jedenfalls unter den vorliegenden konkreten Verhältnissen von Fondskonzepten mit fortlaufenden Einzahlungen der Anleger in das Gesellschaftsvermögen blieb die im Gesellschaftsrechtsverhältnis wurzelnde Vertrauensbeziehung aufrechterhalten. Treten während des Zeitraums der Beteiligung Änderungen derjenigen tatsächlichen Umstände ein, die vermögensbezogen für die Anlageentscheidung maßgeblich waren, müssen die Anleger darüber informiert werden, um ihnen wegen der weiterhin periodisch erfolgenden Zahlungen auch zukünftig eine aufgeklärte Disposition über ihr Vermögen zu ermöglichen. Zu diesen Umständen gehören jedenfalls Schädigungen der Gesellschaftsvermögen, die – was das Landgericht rechtsfehlerfrei festgestellt hat – dazu führen, dass die Beteiligung an der Fondsgesellschaft nicht mehr die bei Aufnahme der Beteiligung versprochenen Zwecke des Vermögensaufbaus und der Altersvorsorge erreichen kann.
Für das besondere Vertrauensverhältnis zwischen einem Geldtransportunternehmen und seinen Geldtransporte beauftragenden Kunden hat der IV. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs eine gemäß §§ 263, 13 Abs. 1 StGB strafbewehrte Aufklärungspflicht der für das Unternehmen Handelnden während laufender Geschäftsbeziehung begangener Veruntreuungen von transportierten Geldern angenommen11. Das entspricht im rechtlichen Ausgangspunkt dem vorstehend Ausgeführten.
Soweit die Geschäftsführer vom Landgericht auch wegen Be- trugs der Anleger solcher Fondsgesellschaften verurteilt worden sind, für die sie nicht oder nicht in allen verfahrensgegenständlichen Zeiträumen als Vertretungsorgan gehandelt haben, gründet sich ihre Aufklärungspflicht vorliegend auf ihr vorangegangenes gefährdendes Tun (Ingerenz) in Gestalt der Begehung von Untreuetaten (§ 266 StGB) zum Nachteil der Fondsgesellschaften und ihrer Anleger bzw. der strafbaren Teilnahme an diesen Taten.
Die Aufklärung der Anleger über die von den Geschäftsführer zu verantwortenden Schädigungen des Vermögens der Fondsgesellschaften und deren Anteilseigner war den Geschäftsführer auch zumutbar. Die Entscheidung, ob ein bestimmtes, den strafrechtlich missbilligten Erfolg abwendendes Verhalten zumutbar ist, muss grundsätzlich von dem dazu berufenen Tatrichter im Rahmen einer wertenden Gesamtwürdigung des Einzelfalles getroffen werden, in die einerseits die widerstreitenden Interessen der Beteiligten und andererseits die Gefahr für das bedrohte Rechtsgut einzubeziehen sind12. Ist mit der Vornahme der rechtlich gebotenen Handlung die Gefahr der Aufdeckung eigener Straftaten des Garanten verbunden, steht dies der Zumutbarkeit normgemäßen Verhaltens gerade wegen des eigenen rechtswidrigen Verhaltens im Vorfeld regelmäßig nicht entgegen13. Auch aus dem Verfassungsrecht lässt sich nicht ableiten, dass Selbstbegünstigung als Ausfluss persönlicher Freiheit stets straflos oder darüber hinausgehend sogar erlaubt sein müsse14. Ebenso wenig schließt das Verfassungsrecht aus, Selbstbegünstigungshandlungen unter Strafe zu stellen, wenn durch diese strafrechtlich geschützte Rechtsgüter Dritter beeinträchtigt werden15.
Bei Anlegen dieser Maßstäbe hat es der Bundesgerichtshof rechtsfehlerfrei für die Geschäftsführer als zumutbar erachtet, die Anleger über die erheblichen Schädigungen der Vermögen der Fondsgesellschaften zu informieren. Im Rahmen der geforderten Abwägung sind die Interessen der zahlreichen Anleger, nicht weiter „wertlose“ Einzahlungen in die Fondsgesellschaften zu leisten, höher gewichtet worden als die Interessen der Geschäftsführer daran, sich nicht der Gefahr eigener Strafverfolgung auszusetzen. Diese Wertung ist nicht zu beanstanden. Ob anderes zu gelten hätte, wenn die rechtlich gebotene Handlung während eines laufenden Strafverfahrens notwendig mit einem Geständnis einherginge16, bedarf keiner Entscheidung. Eine solche Situation war vorliegend nicht gegeben.
Ebenfalls für den Bundesgerichtshof nicht zu beanstanden ist, dass das Landgericht die Geschäftsführer jeweils als Täter der Unterlassungstaten verurteilt hat17.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 8. März 2017 – 1 StR 466/16
- BGH, Urteil vom 25.09.2014 – 4 StR 586/13, BGHSt 59, 318, 323 Rn.19 mwN; siehe auch BGH, Urteil vom 25.07.2000 – 1 StR 162/00, NJW 2000, 3013, 3014[↩]
- etwa BGH, Urteile vom 17.07.2009 – 5 StR 394/08, BGHSt 54, 44, 46 ff. Rn.19 ff.; vom 25.09.2014 – 4 StR 586/13, BGHSt 59, 318, 323 ff. Rn.19 ff.; und vom 04.08.2016 – 4 StR 523/15, wistra 2016, 488 ff.; siehe auch Fischer, StGB, 64. Aufl., § 263 Rn. 38; Satzger in Satzger/Schluckebier/Widmaier, StGB, 3. Aufl., § 263 Rn. 81 jeweils mwN; ausführlich etwa Frisch, Festschrift für Herzberg, 2008, S. 729, 744 ff.[↩]
- vgl. dazu Frisch aaO S. 729, 744 f.; Satzger aaO § 263 Rn. 85; Hefendehl in Münchener Kommentar zum StGB, 2. Aufl., § 263 Rn. 161 jeweils mwN[↩]
- etwa BGH, Urteil vom 16.11.1993 – 4 StR 648/93, BGHSt 39, 392, 399; Beschlüsse vom 08.11.2000 – 5 StR 433/00, BGHSt 46, 196, 203; und vom 02.02.2010 – 4 StR 345/09, NStZ 2010, 502; Urteil vom 04.08.2016 – 4 StR 523/15, wistra 2016, 488 ff. mwN; siehe auch BGH, Urteil vom 09.05.2012 – – IV ZR 19/11, VersR 2013, 1042 ff. und Hebenstreit in Müller-Gugenberger, Wirtschaftsstrafrecht, 6. Aufl., § 47 Rn. 25 mwN[↩]
- Hefendehl aaO § 263 Rn. 161168, Rn.190 f.; Perron aaO § 263 Rn.19 und 22 jeweils mwN[↩]
- Hefendehl aaO § 263 Rn.190; Perron aaO § 263 Rn. 22; Satzger aaO § 263 Rn. 107 jeweils mwN; vgl. auch Hebenstreit aaO[↩]
- RG, Urteil vom 30.01.1931 – I 1387/30, RGSt 65, 106, 107; BGH, Urteil vom 04.08.2016 – 4 StR 523/15, wistra 2016, 488 ff.[↩]
- siehe nur Hefendehl aaO § 263 Rn.190; Satzger aaO § 263 Rn. 107[↩]
- zu den Gründen siehe Radtke in Münchener Kommentar zum StGB, 3. Aufl., § 14 Rn. 41 mwN[↩]
- vgl. zum Problem Seelmann, NJW 1981, 2132; Perron aaO § 263 Rn.19 jeweils mwN[↩]
- BGH, Urteil vom 09.05.2012 – – IV ZR 19/11, VersR 2013, 1042 ff.[↩]
- BGH, Urteil vom 19.12 1997 – 5 StR 569/96, BGHSt 43, 381, 398 f.; siehe auch bereits Urteil vom 20.12 1983 – 1 StR 746/83, NStZ 1984, 164; Kudlich in Satzger/Schluckebier/Widmaier aaO § 13 Rn. 44; Wohlers/Gaede in Nomos Kommentar zum StGB, 4. Aufl., § 13 Rn. 18[↩]
- BGH, Urteile vom 01.04.1958 – 1 StR 24/58, BGHSt 11, 353, 355 f.; und vom 19.12 1997 – 5 StR 569/96, BGHSt 43, 381, 399; vgl. auch Urteil vom 06.05.1960 – 4 StR 117/60, BGHSt 14, 282, 286 f.; Weigend in Leipziger Kommentar zum StGB, 12. Aufl., § 13 Rn. 69; Kudlich aaO § 13 Rn. 44; Wohlers/Gaede aaO § 13 Rn. 18[↩]
- BVerfG, Beschluss vom 29.05.1963 – 2 BvR 161/63, BVerfGE 16, 191, 194[↩]
- vgl. BVerfG aaO BVerfGE 16, 191, 194; siehe auch BGH, Urteil vom 10.02.2015 – 1 StR 488/14, BGHSt 60, 198, 204 f. Rn. 35 f.[↩]
- dazu Wohlers/Gaede aaO § 13 Rn. 18[↩]
- vgl. zu den Kriterien BGH, Urteil vom 12.02.2009 – 4 StR 488/08, NStZ 2009, 321 f. mwN[↩]